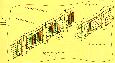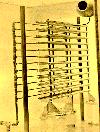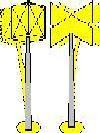Kuriositäten der Windenergie-Nutzung 4
 Den
Vogel schoss aber wohl ein amerikanischer Wissenschaftler 1977 ab, mit
seinem Vorschlag: 'tornado in the cane' oder "der Tornado in der
Cola-Dose".
Den
Vogel schoss aber wohl ein amerikanischer Wissenschaftler 1977 ab, mit
seinem Vorschlag: 'tornado in the cane' oder "der Tornado in der
Cola-Dose".
In einem zylindrischen Bauwerk, mit vertikalen Luftklappen und
Leitblechen an der Mantelfläche, sollte durch intelligente
Klappensteuerung, Öffnen und Schließen je nach Windrichtung,
ein Wirbelsturm im Inneren erzeugt werden.
Mit einer Windturbine kleinen Durchmessers sollte im Turminneren am
Boden, die Energie aus der hohen Wirbelgeschwindigkeit entnommen
werden. Der Wissenschaftler konnte nach seinem einmaligen, einzigen
Vortrag auf einer Internationalen Tagung nicht mehr ausfindig gemacht
werden. Er war für Nachfragen nicht mehr greifbar.
In einem realen, natürlichen Wind wird sich ein innerer Wirbel
nie einstellen.
Das Regelproblem der großen vertikalen Klappen am Umfang darf
auch nicht unterschätzt werden.
Wieder ein Projekt aus dem oder für den Windkanal.
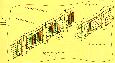
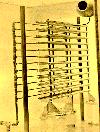
Daß es bei der Windenergienutzung auch ganz ohne bewegte Teile
geht zeigt ein schwedischer Vorschlag aus den Jahren 1977/78. Beim
Durchströmen des Windes durch ein Netzwerk aus Drahtseilen
induziert die an den elektrischen Leitern entlangstreichende, feuchte,
ionisierte Luft einen Stromfluß.
Die Leistungsfähigkeit eines solchen Systems steht allerdings in
keinem Verhätnis zum Aufwand. Das Projekt kam über den
Laborstatus nicht hinaus.


Das Schalenkreuzanemometer zur Windmessung wird immer wieder in
Großausführung als windnutzendes Gerät vorgeschlagen.
Dieses System zur Windmessung ist aber aerodynamisch ein
Widerstandsläufer, also ein uneffektives Gerät.
Der Vorschlag von Fleischer, Witten, 1995, ist selbst als
Fliehkraftregler ausgebildet, bei hohen Drehzahlen kommen die zwei
Halbkugelschalen zur Deckung. Sie bilden eine geschlossenen Kugel die
dem Wind nur noch die Minimalfläche bietet.




Einen neuen Versuch den Wind zu "vergewaltigen" stellt der so
bezeichnete "Windbaum" dar.
Dieses Gerät soll eine ca. tausendfache Leistung gegenüber
der Realität und der wirklichen Leistungsfähigkeit eines
solchen Gerätes haben.
Das System wird sicherlich im Wind drehen, die Leistung wird allerdings
bei den vorgesehenen Dimensionen nur einige hundert Watt betragen. Als
Kunst am Bau, als Firmenlogo oder Signet tauglich, könnte der
Vorschlag die Windenergie als "grüne Energie"
darstellen. Auch die Baumform trägt mit dazu bei.
Das Gerät ist aber keine Alternative zu den herkömmlichen
"Freifahrenden Turbinen", den heutigen modernen
Schnellläufern.
Kontakt: Krauß Energiebaum GmbH&CoKG, Niederlassung Berlin,
Weber & Partner, Rhinstraße 42,
12 681 Berlin, Te.: 030 54687 504, Fax: 030 54687 501
Ein ebenso eigenartiger Vorschlag den Wind zu nutzen stellt die
sogenannte Mamoenergie dar.
Innerhalb dieser Wortschöpfung ist ein ÖKOWIN genanntes
Prinzip, speziell für die energiewirtschaftliche Ausnutzung von
Deformationszuständen an natürlichen (z.b. Bäume) und
künstlichen Gebilden (z.b. Mastkonstruktionen), entwickelt worden.
Dabei sind die elastischen Eigenschaften der Installationsobjekte zur
Einnahme ihrer ursprünglichen Raumlage, bzw. die Rückkehr in
ihren unbelasteten Ausgangszustand, berücksichtigt worden.
Der Patentgegenstand umschließt das sich deformierende Gebilde
wie eine Manschette und nutzt die mechanischen Belastungsmomente und
Lastwechsel bzw. Deformationszustände der Gebilde - auch im
Mikrometer Bereich - zur ökotechnologischen Energiegewinnung.
Für die Installation eines mittelgroßen Baumes werden ca. 50
bis 100 Manschetten mittlerer Größe benötigt. Das
Energiegewinnungssystem arbeitet nach dem Prinzip eines drucksensitiven
elastischen Widerstandbildners. Dabei werden die wechselhaften
mechanischen Belastungsmomente (z.b. durch Wind) mit ihren
zwangsläufig folgenden Lastwechseln auf die ortsfest zugeordnete
Energiegewinnungseinrichtung (Manschette) übertragen. Gleichzeitig
werden die bei der mechanischen Belastung der Gebilde auftretenden
Deformierung auf den translatorisch arbeitenden Generator
(Patentgegenstand) übertragen und von diesem zur Störung und
Neueinstellung seines Systemgleichgewichtes - bei gleichzeitiger
Energieabgabe - aufgenommen.
Die Einsatzmöglichkeiten dieses Energiegewinnungssystems
erstrecken sich vorzugsweise auf pflanzliche Gebilde, die ohne
Beeinträchtigung ihrer ökologischen Funktion als
umweltverträgliche Energiespender multifunktional genutzt werden.
 unbelastet
unbelastet  belastet
belastet 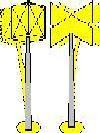 künstlicher "Baum"
künstlicher "Baum"
Es ist nicht geklärt, ob ein solches Konzept funktionieren wird.
Es ist auch zu bezweifeln ob diese Energiewandlungsart überhaupt
der Windenergienutzung zugeordnet werden kann.


doerner@ifb.uni-stuttgart.de
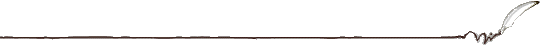 Seit 3.
August 1998
Seit 3.
August 1998
 Den
Vogel schoss aber wohl ein amerikanischer Wissenschaftler 1977 ab, mit
seinem Vorschlag: 'tornado in the cane' oder "der Tornado in der
Cola-Dose".
Den
Vogel schoss aber wohl ein amerikanischer Wissenschaftler 1977 ab, mit
seinem Vorschlag: 'tornado in the cane' oder "der Tornado in der
Cola-Dose".